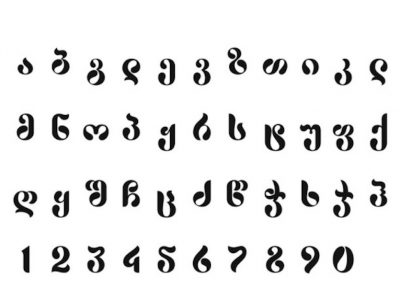Wandmalerei im Geflüchtetenlager Ritsona, von Ismail Yazidi (3. Mai 2016). Das Foto ist auf der Facebook-Seite des Geflüchtetenlagers zu finden.
Von Mai El-Mahdy
Syrische Geflüchtete in Griechenland. Es gibt sicher schon tausende Blogposts, Zeitungsartikel und Augenzeugenberichte darüber, wie ganze Familien im Ozean ertrunken sind, während sie verzweifelt auf ein Leben ohne Krieg und Armut hofften. Und bestimmt noch viele weitere über diejenigen, die von der Erbarmungslosigkeit der See verschont wurden, nur um letztendlich in menschenunwürdigen “Übergangslagern” anzukommen, wo sie möglicherweise Jahre verbringen würden.
Aber um Geflüchtete, das Leben, das sie in Syrien zurückgelassen haben, oder ihre Odyssee, die sie bis nach Griechenland geführt hat, soll es hier nicht gehen. Vielmehr möchte ich über diejenigen unter uns sprechen, die versuchen, sie zu unterstützen – über ihre Situation und darüber, welche Rolle ihnen in der Lösung dieser humanitären Krise zukommt (und welche nicht).
Vor kurzem habe ich ein paar Wochen im Geflüchtetenlager Ritsona in Griechenland verbracht. Neben den Handlungsträgern der Vereinten Nationen sind hier fünf verschiedene humanitäre Nichtregierungsorganisationen tätig. Bei Ritsona handelt es sich um einen alten Militärstützpunkt außerhalb von Chalkida, der Hauptstadt der Insel Euböa, die mit dem Auto ungefähr eine Stunde nördlich des Stadtzentrums in Athen gelegen ist. Der Anteil der hier ansässigen Syrer macht etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung auf der Insel aus – das restliche Drittel besteht aus Kurden, Irakern und Afghanen.
Versunkenene Würde
Es ist schwer, es sich vorzustellen – und noch schwerer, so zu (über)leben – aber es gehört zur grausamen Realität des Lebens in diesen Lagern, dass jegliches Gefühl von Selbstachtung abhandengekommen ist. Von der eigenen Würde ist kaum noch etwas zu spüren – als wäre sie von der rauen See verschlungen worden und bis auf den Grund hinabgesunken. Was bleibt, ist eine verkümmerte Art von Würde, dank derer man sich glücklich schätzt, wenn man aus einem Zelt aus- und in eine krude mobile Containerbox einzieht und Monat um Monat unter diesem Obdach verbringt, das als Übergangslösung gedacht war. Die Art von Würde, die in den Händen der Nichtregierungsorganisationen, in die man sein ganzes Leben legt, nahezu ganz verloren geht; durch ihre Autorität und die Entscheidungen, die sie für die Geflüchteten treffen, bringen sie den Geflüchteten bei, sich mit dem wenigen zufriedenzugeben, was sie bekommen, und glücklich zu sein. Warum tun wir das, wo diese Menschen doch ohnehin schon gebrochen sind? Wissen wir ehrenamtliche Helfer wirklich immer, was das Beste für sie ist? Würden wir es umgekehrt anderen erlauben, uns auf ähnliche Art Entscheidungen abzunehmen?
Es geht hier nicht darum, anderen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und ihre eigenen Fehler zu machen. Sondern um Selbstbestimmung. Die Flüchtenden nehmen jedes erdenkliche Risiko auf sich, verlassen sich auf Faktoren, die niemand auch nur ansatzweise beeinflussen kann, und kommen letzten Endes wie durch ein Wunder in einem Lager an, wo sie die Entscheidungen anderer befolgen müssen – ganz gleich, wie gut oder schlecht diese sind.
“Bringen wir ihnen Englisch bei!” Jeder will und muss Englisch sprechen können, nicht? “Kaufen wir Spielzeug für die Kinder!” – und lassen dabei die Wünsche der Eltern und die Kinder selbst völlig außer Acht.
Die bittere Realität ist: Man muss akzeptieren, dass man aufgrund von Gegebenheiten, die man in keinster Weise beeinflussen kann, seinen eigenen Wert als Mensch verliert; ein Umstand, der durch das Schlange stehen an der Essens- oder Kleiderausgabe umso deutlicher wird.
Geflüchtete wollen nicht stundenlang für Essen oder Kleider Schlange stehen. Sie wollen wie Menschen behandelt werden, genauso wie ein schwarzer Mann im Südafrika der Apartheid-Ära, ein Palästinenser, der mit der Belagerung durch Israel konfrontiert wird, oder wie Frauen auf der ganzen Welt. Ein Teil dessen, was so verletzend an dieser ganzen Sache ist, ist die Erkenntnis, dass wenige Menschen außerhalb der eigenen Gefahrenzone es ertragen, geschweige denn einen Gedanken daran verschwenden müssen, in so einer Situation zu sein. Es ist ein Teil des Frustes, den man verspürt, wenn man vor die Unwahl gestellt wird, sich entweder dankbar dafür zu erweisen, am anderen Ende der Schlange Essen zu finden, oder auf einem Foto die Runden durch die sozialen Medien zu machen und von anderen bemitleidet zu werden.
Vielleicht wäre es besser, wenn wir unseren Umgang mit Geflüchteten als ein Recht ansehen, das sie sich verdient haben – nicht als Barmherzigkeit, die wir ihnen erweisen, weil wir es wollen. Vielleicht sollten wir es ihnen ermöglichen, für sich selbst zu kämpfen. Vielleicht geht es einfach darum, sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen zu lassen, ganz gleich, wohin sie dieser Weg führt und wo unser Platz ist. Wir sollten unsere Kräfte dafür aufwenden, sie darüber aufzuklären, welche Rechte sie in den Ländern haben, denen sie zugeteilt werden – wir sollten uns um ihre Gesundheit kümmern, um ihre Bildung und die ihrer Kinder, usw.
Vielleicht sollten wir ihnen so begegnen, wie wir wollen würden, dass sie uns begegnen: Mit Würde und Selbstachtung.
Helfen wir auch?
Es ist schon amüsant, wie man von uns freiwilligen Helfern erwartet, dass wir wie selbstverständlich auf die Bühne treten und mit allen anderen daran arbeiten, alle Steine ins Rollen zu bringen. Als wären wir nicht Teil der Geschichte, sondern Außenstehende, die nur dann relevant sind, wenn es um die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe geht. Aber ob es uns gefällt oder nicht: Wir sind durchaus Teil dieser Geschichte und haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf deren Verlauf.
Wir, als individuelle Wesen, haben stets mit unserem Ego zu kämpfen. Es ist die eine Sache, sich dessen bewusst zu werden (und tatsächlich sind selbst dazu nur sehr wenige Helfer in der Lage). Unser Ego an zweite Stelle zu stellen, ist allerdings eine ganz andere Angelegenheit. Für einige Helfer ist es leichter, ihr eigenes Ego aufzubauen, als diejenigen, die in Not sind – das ist wahrscheinlich unvermeidbar. Und die Belohnung dafür ist so verlockend, dass viele von ihnen es verlernen, kurz innezuhalten und sich zu fragen: Helfen wir diesen Menschen auch?
Es verwundert nicht, dass sich viele Freiwillige vor allem auf Kinder konzentrieren, wenn man bedenkt, wie schnell diese sich an andere binden. Aber inwiefern ist das eine Hilfe?
Freiwillige Helfer können nicht anders, als sich überlegen zu fühlen. In den Lagern stechen sie heraus, und das nicht immer ganz ohne eigenes Zutun. Oft verstehen sie sich als Menschen, die anderen einen wertvollen Dienst erweisen und dafür einen großen Teil ihrer Zeit und ihres Wissens aufbringen. Und sie erwarten von den anderen, ihnen Dankbarkeit zu zeigen und sie daran zu erinnern, was für vorbildliche Menschen sie sind.
Dabei ist es kein Dienst, den man Geflüchteten erweist. Es ist ihr Recht – es steht ihnen zu.
Und so etwas sollte nicht zur Debatte stehen.
Einmal, als wir für die Menschen in Ritsona einkaufen gehen wollten, feilschte ich mit der Kassiererin in der Hoffnung, etwas mehr für mein Spendengeld zu bekommen. Die Kassiererin, die ihrerseits auch Ägypterin war und ihren Lebensunterhalt auf der anderen Seite des Mittelmeers verdiente, erklärte sich bereit, mir zu helfen. Aber anstatt den Preis zu verringern, bot sie mir an, einen höheren Betrag auf die Rechnung zu schreiben. Wie sie mir erklärte, nahmen viele Freiwillige und Mitarbeiter der Nichtregerierungsorganisationen die gefälschten Rechnungen entgegen und kassierten die Differenz zwischen dem Betrag auf der Rechnung und dem tatsächlich bezahlten Geld selbst ein. So war ihr auch aufgefallen, dass ich zum ersten Mal davon hörte. Und nein: Was den Preis anging, ließ sie nicht mit sich reden.
Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Einige Freiwillige finanzieren sich ihre eigenen Reisen aus Spendengeldern. Trotz Aufrufen zu höherer Transparenz machen nur wenige Nichtregierungsorganisationen ihre Finanzen publik. Nicht, dass das besonders viele Spender interessieren würde. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wäre das hier wohl ein guter Anfang.
Meiner Meinung nach ist der beste Weg, Geflüchteten zu helfen, die Nichtregierungsorganisationen komplett zu umgehen. Es ist nicht schwer für uns, auf direkte Art und Weise Kontakt zu Geflüchteten herzustellen. Sie sind Menschen, genau wie wir, nur dass sie schlechteren Umständen ausgesetzt sind. Sie wie Patienten zu behandeln, die an irgendeiner Krankheit oder Art von Behinderung leiden, ist keine große Hilfe.

Geflüchtete. Foto: Pixabay, lizenzfreier Zugang.
Einer meiner Freunde sieht das anders. Er erzählt von einem deutschen Arzt; ein älterer Herr, der seinen Job äußerst professionell und sorgfältig ausführt. Er versteht es als seine Pflicht, seine Patienten so gut zu behandeln, wie es ihm seine Fähigkeiten und die räumlichen Gegebenheiten erlauben. Von morgens bis abends lässt dieser Arzt Patienten zu sich kommen; er untersucht sie und behandelt sie. Er spricht nicht die Sprache des Landes, in dem er arbeitet, und wirkt distanziert, wenn nicht sogar kühl. Aber er behandelt nicht nur jede einzelne Person, der er begegnet, sondern baut zudem eine ärztliche Einrichtung auf und trainiert die Arbeiter dort, damit das Projekt auch nach seiner Abreise fortbestehen kann. Viele kennen ihn nicht, viele kümmert er nicht und viele erinnern sich noch nicht einmal an ihn, obwohl er die Gemeinschaft auf direkte Weise unterstützt und weitergebracht hat.
Kein Wunsch nach Anerkennung. Keine Zurschaustellung. Keine Emotionen. Sondern purer Pragmatismus.
Ich kann nicht sagen, dass ich da anderer Meinung bin. Freiwillige Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen haben strikte Regeln zu befolgen – zum Beispiel müssen sie um 17 Uhr das Lager verlassen. Weil ich diese Regel hasste, zog ich nach ein paar Wochen aus der Wohnungseinrichtung der Organisationen aus und in das Lager ein. Ich wohnte mit einer befreundeten Geflüchteten und ihren zwei Töchtern in ihrem Container. Ich könnte niemals behaupten, dass ich ihr Leben gelebt habe, aber es hat mir durchaus einen genaueren Blick auf ihr Leben gewährt.
Einerseits bin auch ich der Meinung, dass eine distanzierte und professionelle Einstellung sehr wirkungsvoll und effektiv sein kann. Andererseits denke ich auch, dass Nähe wichtig ist. Ja, am Ende des Tages gehen wir immer, und es mag sein, dass wir mehr Zeit und Kraft darin investieren, enge Freundschaften mit den Geflüchteten aufzubauen, als konkrete, greifbare Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und ich gebe zu, dass ich mehr von den Geflüchteten über die kulturellen und politischen Hintergründe Syriens gelernt und weniger mein eigenes Wissen mit ihnen geteilt habe.
Aber indem wir tiefe emotionale Bindungen eingehen, erinnern wir andere (und uns selbst) daran, dass wir Menschen sind. Und es ist dieser Prozess selbst, der uns menschlicher macht.
In Krankenhäusern wird nicht immer die eigene Sprache gesprochen
Die alltäglichen medizinischen Bedürfnisse der Lagerbewohner in Ritsona, von denen es jede Menge gab, wurden praktisch komplett ignoriert. In Notfällen transportierte jedoch der griechische nationale Rettungsdienst (EKAB, Ethniko Kentro Amesis Voitheias) die Bewohner des Lagers zum nächstgelegenen Krankenhaus und wieder zurück.
Niemand ist gerne im Krankenhaus, aber für syrische Geflüchtete in einem fremden Land ist es schlimmer, als man sich vorstellen kann. Einsamkeit und Angst vor dem Unbekannten setzen ihnen massiv zu; man sieht es in ihren Augen. Und insbesondere von Kindern fordert die lange und gefährliche Reise zum Lager ihren Tribut; die meisten von ihnen leiden unter starken Atmungsbeschwerden.
Allerdings sprachen viele der griechischen Ärzte weder Englisch, noch hatten sie Dolmetscher. Die meisten Patienten wiederum konnten sich nur auf Arabisch oder Kurdisch ausdrücken. Die Lagerbewohner warteten oft stundenlang auf Notfallpflege im Krankenhaus, nur um letztendlich die Hoffnung, jemals verstehen zu können, wie sie an Hilfe kommen konnten, zu begraben und wieder zu gehen.
Im Lager war es Teil meines Jobs, die Patienten zu begleiten; dabei war mir mein Arabisch eine große Hilfe. Letzen Mai startete eine der Nichtregierungsorganisationen in Ritsona eine einzigartige und bahnbrechende Initiative namens “Hospital Runs”; ich war Teil dieses Teams. Das Programm entstand in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz und funktioniert unter Genehmigung der griechischen Armee. Zu den Dienstleistungen, die zur Verfügung gestellt werden, zählen medizinische Transporte, Dolmetscher für das Englische, Griechische und Arabische, und interkulturelle und medizinische Hilfestellung. Das Team kommt auch bei bürokratischen Prozessen zum Einsatz.
Ich war stolz darauf, ein Teil dieses Teams zu sein. Jeden Tag hüpften wir hinüber auf Chalkida oder marschierten den weiten Weg bis nach Athen und kehrten am Abend wieder zurück, nachdem wir uns mit all den Problemen, Fällen und Komplikationen auseinandergesetzt hatten, mit denen wir begrüßt wurden.
Manchmal gab uns das Krankenhauspersonal das Gefühl, wir wären nicht willkommen. Zum Beispiel beschwerten sie sich einmal darüber, dass wir das Gebäude mit schmutzigen Schuhen betraten – die Tatsache, dass das Lager praktisch im Matsch errichtet wurde, ließ sie vollkommen kalt. Ich weiß noch, wie ich einmal im Krankenhaus ankam und eine junge, eindeutig arabische Frau sah, die höchstwahrscheinlich aus dem Lager stammte. Sie war vollkommen allein – niemand schenkte ihr Aufmerksamkeit – und sie hatte es offensichtlich aufgegeben zu versuchen, sich mitzuteilen oder sich vor dem Schmerz zu befreien, der sie zusätzlich zu all der anderen Last von der Reise auf diesen Kontinent befallen hatte. Sie erklärte mir ihre Umstände und gab mir die Telefonnummer einer ihr nahestehenden Person, sodass ich diese darüber in Kenntnis versetzen konnte, sollte sie es nicht schaffen. Glücklicherweise, und entgegen allen Erwartungen, überlebte sie.
Im Grunde ist es mir wohl unbegreiflich, wie Grenzen und Gewässer letztendlich darüber entscheiden können, wer sich ans Ufer retten darf, und wer dazu verdammt ist, zu ertrinken und auf den Grund hinabzusinken.