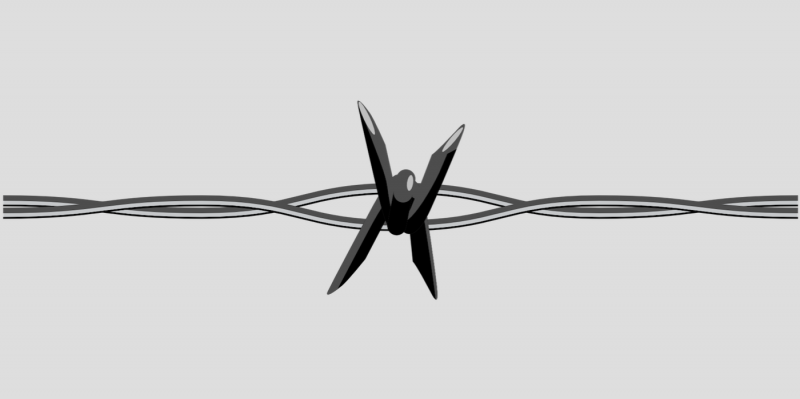Dies ist der vierte Bericht in der sechsteiligen Reihe „Schlaf oder Tod“, in der der Aktivist Sarmad Al Jilane von seinen Erlebnissen in einem syrischen Gefängnis erzählt. Hier sind die Teile eins, zwei und drei zu lesen.
Trotz allem, was wir die vergangene Woche mitmachen mussten, trotz der Schläge, der Folter, der Entfernung unserer Fingernägel, trotz des Stroms, der unsere Körper stärker durchströmt als die elektrischen Leitungen in diesem Gefängnis, haben einige von uns immer noch genug Kraft, sich gegen ihren Henker aufzulehnen.
Am achten Tag holen sie mich, Abdul Rahman und viele andere Gefangene aus unserer Zelle. Vor der Tür hält der Vernehmer einige Blätter Papier gegen die Wand und gibt uns einen Kugelschreiber: „Los, unterschreiben.“ Ich versuche, den Inhalt des handgeschriebenen Textes so genau wie möglich zu erfassen. Es scheint sich um den Vernehmungsbericht zu handeln. Ein paar Ohrfeigen und Hiebe von der Metallstange in seiner Hand halten mich davon ab, mehr auszumachen. „Nicht lesen, unterschreiben habe ich gesagt, du Hund.“ Unter weiteren Beleidigungen unterschreibe ich, unterschreiben wir alle, und dann kehren wir in unsere Zelle zurück und warten.
Wir sind weder Afghanen noch Terroristen. Keiner von uns weiß, wie man einen selbstgebastelten Sprengsatz anbringt, und keiner von uns hat den heiligen Dschihad ausgerufen; in unseren Augen bedeutet die Revolution Freiheit. Wir haben niemanden des Abfalls vom Glauben bezichtigt; wir haben nicht vor, die Welt zu säubern. Wir sind keine Mörder, wir haben niemanden verletzt. Unser einziges Verbrechen war, dass wir laut gedacht und unsere Forderungen klar und deutlich ausgesprochen haben.
Die Tage ziehen vorbei; wir sind von unserem eigenen, improvisierten Kalender abhängig. Ein Strich nach unten für jeden Tag, der kommt und geht, und am fünften Tag fährt ein horizontaler Strich quer über die anderen vier. Die Tage, an denen einer von uns freikommt, markieren wir mit kleinen Kreisen, aber das ist für Menschen wie mich, die von einem Gefängnis direkt ins nächste wandern, nicht gerade die beste Art von Kalender, da wir unsere Striche und unser Blut an den Wänden zurücklassen.
Der Wächter kommt. Nachdem er Abdul Rahman befiehlt, seine Sachen zusammenzusuchen, nimmt er ihn mit. Abdul Rahman wiederum geben wir Nachrichten für unsere Geliebten mit und er versucht, sich so viele Telefonnummern wie möglich einzuprägen, um unseren Familien ein kleines bisschen Hoffnung zu spenden. Sie gehen und ich bleibe zurück, nunmehr alleine unter siebenunddreißig weiteren einsamen Seelen.
Und dann, lange Zeit später, kommt der ersehnte Tag, an dem mein Name nicht auf der Liste steht, die der Wächter laut verliest. „Sarmad, pack deine Sachen und komm mit mir.“ Er verdeckt mir weder den Kopf, noch legt er mir Handschellen an. Meine Freude lässt mich fast die Nummern vergessen, die ich mir für meine Zellengenossen merken sollte. Wir gehen hinaus in den Hof. Die immer gleichen Begrüßungsrituale folgen, nur diesmal natürlich zum Abschied. Sie legen unsere Wertsachen in Säcke und binden uns an eine lange Kette. Ich fühle, wie mir das Herz in den Fußsohlen pocht. „Die Damaskus-Kette ist fertig, bring sie zur Tür. Sie werden nach zwei Tagen in der Kaserne der Militärpolizei dorthin transferiert“, sagt ein Wächter voller Stolz. Er rückt sein rotes Barett zurecht, während wir alle in den Bus steigen.
Wir verlassen das Gefängnis. Ich kann das Haus meiner Großeltern sehen – wir fahren direkt daran vorbei! Einige Städte verkörpern die Tragödie, die unsere Lebensgeschichte darstellt; schon seit Anbeginn der Welt haben sie unser Schicksal in Stein gemeißelt und verwandeln die Oase unserer Kindheit und Jugend in das Schlachthaus, in dem wir geopfert werden. Die Revolution lastet schwer auf meinen Schultern, während ich im Bus mein Zuhause an meinen Augen vorbeiziehen sehe, nur ein paar Meter und doch eine Welt der Tyrannei entfernt. Ich und mein Zuhause, getrennt durch ein ganzes Regime – als wäre ein junger Mensch, der gerade eben erst volljährig geworden ist, für all das verantwortlich, was mit unserem Land geschehen ist. In diesem Moment fange ich zum ersten Mal zu weinen an.
Wir betreten die Kaserne der Militärpolizei in Deir ez-Zor. Wir steigen aus dem Bus aus und versammeln uns auf einem kleinen Flecken Gras im Hof. Dort sitzen acht Wächter, jeder mit einer Peitsche in der Hand. Reifen von allen Größen liegen verstreut in der Gegend herum. Ein Wächter nimmt unsere Papiere und unsere Sachen und der Rest führt uns hinein. Sie ketten uns los. Jeder der Wächter schnappt sich einen von uns und einen passenden Reifen. Und dann geht das „Bereifen“ los; so nennen sie das, was sie gleich mit uns machen werden.
Mein Wächter zwängt mich in den Reifen, stößt mich zu Boden und fängt an, auf mich einzudreschen. Er hört nicht auf, bis er Blut sieht, was nicht weniger als fünfzehn Schläge erfordert. Sie führen uns zu einer Gefängnisanlage, die aus einem großen Bad und drei riesigen Einheiten besteht, die durch eine lange Halle in der Mitte miteinander verbunden sind. Die Stimmen der Gefangenen werden lauter. „In ein paar Stunden gibt's Mittagessen; irgendwelche Wünsche?“ Wir sind überrascht zu erfahren, dass man die Wächter hier dafür bezahlen kann, dass sie einem alles bringen, was man möchte. Andererseits liegt unser Geld in den Säcken, die sie konfisziert haben, also was nützt es uns? Das Mittagessen wird serviert und in Anwesenheit der anderen Insassen brechen wir endlich unsere Diät aus Bulgur, Kartoffeln und Hühnerknochen ab.
Dann stehen Besuche an. Einer der Gefangenen kennt meinen Onkel, und als ihn seine Ehefrau besuchen kommt, bittet er sie darum, meine Eltern anzurufen. Das tut sie auch, und eine Stunde später kommt ein Wächter mit fünfzehntausend syrischen Lira und einem Bündel Klamotten auf mich zu, die mir viel zu groß sind, oder vielleicht haben sie mir vor meiner Zeit im Gefängnis noch gepasst. Sei's drum; Hauptsache, es nimmt mir ein bisschen die Nervosität und die Anspannung. Und was noch wichtiger ist: Die neuen Klamotten nehmen mir die Last von den Schultern, die damit einhergeht, auf die blaue Jacke aufzupassen, die ich behutsam unter meinem Pullover versteckt hatte.
„Das ist für dich. Besuche sind dir nicht gestattet, das hat dir jemand mitgebracht.“ Ich sollte erst viel später, nämlich nach meiner Freilassung erfahren, dass es Aghyad war, der mir diese Sachen gebracht hatte. Der Wächter hatte ihm den Besuch verweigert und eintausend Lira dafür gefordert, die Sachen an mich weiterzureichen. Hier wird die Identität eines jeden Besuchers geprüft; wäre Aghyad hereingelassen worden, wäre er nicht lebend wieder herausgekommen. Er wird gesucht, und der Vernehmer hatte ihn ganz besonders im Fokus.
Wir gehen wieder hinein, ich inzwischen in meinen neuen Klamotten. Ich setze mich und warte darauf, verlegt zu werden. Zwei Tage vergehen; am dritten Tag werden wir in den Militärsicherheitszweig von ar-Raqqa übergesiedelt. Es spielen sich die immer gleichen Rituale ab; auch sie wurden mit der Schändlichkeit der Baath-Partei indoktriniert. Nach zwei weiteren Tagen kommen wir nach Aleppo, genauer gesagt, in die Kaserne der Militärpolizei in Al-Jmaylie. Das war das letzte Mal, dass ich Aleppo sehen sollte. Ich erhasche einen Blick aus dem Busfenster, während sie mir den Kopf zwischen die Beine drücken. Das ist ein Moment des Triumphes: Nachdem ich mich so viele Tage lang danach gesehnt hatte, die Straßen, die Menschen für einen kurzen Augenblick wieder zu sehen, hatte ich genau das geschafft. Vor allem das Café Al-Yamani fiel mir auf, und der Name ist mir auch jetzt, vier Jahre später, immer noch im Gedächtnis eingebrannt.
Wir kommen in der Kaserne der Militärpolizei an. Uns werden die Köpfe verhüllt und die Ketten abgenommen. Wir betreten das Gebäude und betreten zu vierzigst einen großen Raum. „Alle an der Wand aufstellen und ausziehen, wir führen zwei Sicherheitsmaßnahmen durch. Na los!“, bellt ein Wächter, während er uns die Köpfe wieder freilegt. Er ist mager, nicht größer als einen Meter siebzig, und er hält einen schwarzen Stock in der Hand, der fast genauso lang ist wie sein Bein. Wir sind nackt bis auf die Knochen und rühren uns nicht, während er uns beäugt. Das ist das erste Mal, dass wir sexuell missbraucht werden. Er fährt mit dem Stock über unsere Genitalien und Gesäße, klopft manchmal provokativ dagegen. Er missbraucht jeden einzelnen von uns, als würde er Rache an irgendeiner Art Dämon nehmen. Sie müssen unsere Freiheitsgesänge wie eine Art Vergewaltigung empfunden haben, und jetzt hat ihre Stunde der Rache geschlagen.
Auf seinen Befehl hin ziehen wir uns wieder an. Unser Geld bekommen wir zurück, die Beutel mit unseren Wertsachen allerdings nicht. Dann werden wir auf unsere Zellen verteilt, in denen wir Tee, Zigaretten und alle möglichen verbotenen Gegenstände vorfinden. All die Zeit, in der ich daran geglaubt hatte, dass dich ein einziger Schluck Tee und ein Zug von einer Zigarette der Marke Alhambra ins Leben zurückholen können. Obwohl wir nur zu siebt sind, bitten wir um eine Fünfliterkanne Tee, außerdem um Zigaretten und jede Menge Essen. So läuft das hier: Man fragt sie nach Essen und all diesen alltäglichen, bedeutungslosen Dingen, die eigentlich zu den Grundrechten eines jeden Menschen zählen, und dann dankt man ihnen dafür, dass sie einem die Sachen gebracht haben, die man mit dem eigenen Geld bezahlt hat – und das alles, während man eingesperrt ist und gefoltert wird. Weil ich gerade Turnschuhe anhabe, nutze ich die Gelegenheit und verstecke vorsichtig eine Zigarette unter der Sohle; ich werde später darauf zurückkommen.
Die nächsten zwei Tage gehen schnell vorbei. Dann werden wir wieder versetzt. Derselbe riesengroße Raum. Sie binden uns alle an eine Kette. Taher ist auch da! Er streitet sich mit einem Wächter, ihre Stimmen werden langsam lauter. „Ich habe dir gesagt, ich war das Oberhaupt meines Clans, und weder du noch sonst jemand kann daran was ändern. Binde mich los und bring mich zum Anfang der Schlange!“ Taher brüllt, ohne sich auch nur im Geringsten um seine Umgebung zu scheren. Nach einer langen Auseinandersetzung bindet der Wächter ihn los und am Anfang der Schlange wieder an.
Der Oberst hinter dem Tisch fängt an, die Transferpapiere abzustempeln. Taher läuft langsam nach vorne (alle Blicke sind auf ihn gerichtet), holt einige Tüten mit mehreren Laiben Brot aus dem Schrank neben dem Oberst heraus und beginnt, diese unter den Gefangenen zu verteilen. Der Oberst schreit ihn dafür an. „Mein Herr, ich werde erst dann wirklich wach, wenn ich etwas gegessen habe, und du weißt, dass ich nichts essen kann, während alle anderen zusehen. Deshalb dachte ich, es wäre besser, wenn ich diesen armen Männern ebenfalls ein Stück Brot gebe.“ So sehr er sich auch anstrengt, eine ausdruckslose Miene aufzusetzen: Wenn Taher redet, hat er stets ein Lächeln auf dem Gesicht. Ein Wächter prügelt so lange auf ihn ein, bis er zu Boden fällt.
Er wartet, bis sich der Wächter davonmacht, und dann richtet Taher sich mühevoll auf und setzt sich auf den metallenen Stuhl direkt neben dem Tisch. Der Oberst blickt auf und versucht, seinen Zorn zu verbergen. Ein Wächter eilt herbei, um Taher erneut zu schlagen. „Mein Herr, sind wir nicht alle Söhne unseres Herrn Präsidenten, unseres Anführers? Kannst du dein Herz mit der Vorstellung in Einklang bringen, dass es deinem Bruder, der im selben Land geboren wurde wie du, der denselben Anführer hat, nicht gestattet ist, sich kurz auf diesem Stuhl auszuruhen?“ Der Oberst bricht in Gelächter aus, als er Tahers Worte hört, und legt seinen Stempel beiseite.
Sie führen uns hinaus in den Hof. Eigentlich rechnen wir damit, dort einen Bus zu sehen, doch es erwartet uns ein Laster, der aussieht wie ein Gemüsetransporter. Wir drängen uns auf die kühle Ladefläche im hinteren Teil des Wagens – dreiundneunzig Menschen, zusammengepresst wie die Ölsardinen in der Dose. Ein Freund zeigt mir, wie man die Handschellen lockert, denn der Weg ist lang. Niemand spricht. Stattdessen herrschen Stille und Furcht vor dem, was kommen wird.